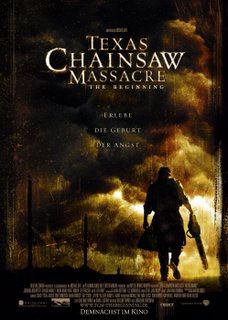Dreamgirls - Das Streben nach Glück
 USA 2006
USA 2006Es war der Sound einer neuen Ära. Motown. Der Name eines Plattenlabels stand stellvertretend für etwas Aufregendes, etwas Anderes. Schwarze Musik. Geboren in den Clubs von Detroit, versetzte die soulige mit Rock’n’Roll-Einflüssen versetzte Musik eine ganze Generation in Ekstase. Mitverantwortlich für diesen Siegeszug waren die „Supremes“ mit der später auch als Solokünstlerin sehr erfolgreichen Diana Ross. Zwölf Nummer Eins-Hits in den USA sprechen eine eindeutige Sprache. Basierend auf der Geschichte der „Supremes“ entstand Anfang der 80er Jahre nach einer Vorlage von Tom Eyen ein populäres Broadway-Musical, was Oscar-Gewinner Bill Condon (Gods & Monsters, Kinsey) wiederum als Quelle für seinen neuen Film Dreamgirls diente.
Aus den „Supremes“ wurden so die „Dreamettes“. Drei talentierte junge Sängerinnen, die den Traum fast aller Künstler träumen. Berühmt und erfolgreich zu werden, mit dem, was ihnen am meisten bedeutet. Doch bis es soweit ist, müssen sich Deena (Beyoncé Knowles), Lorrell (Anika Noni Rose) und Lead-Sängerin Effie (Jennifer Hudson) mit kleinen Auftritten herumschlagen. Das Showbiz ist kein Ort für zartbesaitete Naturen, das lernen die Drei schnell. Als sie von James „Thunder“ Early (Eddie Murphy), einem der Vorreiter des neuen Detroit Sound, als Background-Sängerinnen engagiert werden, nimmt ihre Karriere erste Konturen an. Ihr Entdecker und Manager Curtis Talyor jr. (Jamie Foxx) ist sich sicher, dass die Mädels eines Tages groß rauskommen werden. Nur dazu bedarf es vorher einiger nicht unerheblicher Veränderungen. Deena, Lorrel und Effie sollen fortan unter dem Namen „The Dreams“ vermarktet werden, mit Deena als der neuen Lead-Sängerin. Ihre Schönheit und Eleganz – so das Kalkül – werde der Gruppe zum Durchbruch verhelfen.
Regisseur und Drehbuchautor Bill Condon kennt sich aus mit Glamour, Musicals und der kinogerechten Adaption berühmter Lebensläufe. Die Erfahrungen aus seinen früheren Werken wie Gods & Monsters, Kinsey und vor allem Chicago fanden allesamt Verwendung für diese Geschichte über den langen Weg an die Spitze, die stets eine Spur zu plakativ den in die amerikanische DNS eingepflanzten Glauben an das scheinbar Unmögliche zelebriert. Es knirscht ohnehin an unerwartet vielen Ecken im Gebälk. Ganz im Gegensatz zum schwungvollen wenngleich überschätzten Chicago fehlt es den Musical-Nummern in Dreamgirls zumeist an einer phantasievollen Einbindung in den Plot. Die Handlung wird durch die Gesangseinlagen kaum vorangetrieben, sie stagniert und wirkt wie eingefroren. Das Ganze besitzt dadurch weniger den Charakter eines Films als des eines überlangen Musikclips.
Um ein weiteres Mal den Chicago-Vergleich zu bemühen, sei auf die Qualität der Musikstücke hingewiesen. Abseits des neu produzierten „Listen“ und dem von Newcomerin Jennifer Hudson mit Verve und Leidenschaft vorgetragenen Statement „And I Am Telling You I'm Not Going“ als Replike auf Curtis Entscheidung, Effie aus der Besetzung zu nehmen, bleibt nur wenig hängen. Viele Songs erscheinen austauschbar oder sind einander zu ähnlich. Originelle Verknüpfungen wie Chicagos „Mr. Cellophane“ oder „Cell Block Tango“ sucht man vergebens.
Wäre die Geschichte nicht dünner als ein Blatt Papier und in ihrem Kitsch wie bei dem gemeinsam intonierten „Family“ nicht entsetzlich banal, könnte sich der Zuschauer stattdessen zumindest an deren Fortgang erfreuen. Doch so gehen einem schnell die Argumente aus, weshalb es sich lohnen würde, für diese Dreamgirls ein Kinoticket zu lösen. Sicherlich, Jennifer Hudson ist mit ihrer geballten Stimmkraft ein Erlebnis und sogar schauspielerisch macht sie eine überaus gute Figur – was sich von Miss Knowles, die außerhalb der Musical-Einlagen in ihrer durchgestylten Erscheinung eher wie „Black Barbie“ aussieht, nicht behaupten lässt – aber auch sie kann den 128 Minuten langen Film nicht alleine tragen. Der restliche Cast erfüllt die ihm jeweils zugedachte Rolle pflichtgemäß. Foxx, Murphy und Altmeister „I’m too old for this Shit“ Danny Glover fungieren als Stichwortgeber für die drei Ladys.
Die Idee, den Plot mit politischem Gewicht beschweren zu wollen – immerhin böten die 1960er Jahre mit ihren Rassenunruhen dafür reichlich Material – verwirft Dreamgirls bereits nach einigen schüchternen Beobachtungen der Schwarz/Weiss-Problematik. Politisch ist Condons langweilige Perücken-Show eher aus einem anderen Grund. Wie der vor kurzem gestartete Das Streben nach Glück, der seine gesamte Agenda im Titel trägt, beschwört er am Beispiel afroamerikanischer Protagonisten den fiskalisch messbaren Erfolg als den entscheidenden Gradmesser eigener Zielereichung. „Auch Du kannst es schaffen!“ schreit uns Dreamgirls unverhohlen entgegen. Welch ein Albtraum.