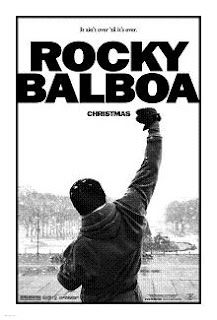USA 2007
++The Hitcher läutet eine weitere Runde im besonders bei Horrorproduktionen grassierenden Remake-Wahn ein. Knapp zwanzig Jahre, nachdem Rutger Hauer als psychopathischer Anhalter John Ryder einem jungen Pärchen das Leben zur Hölle machte, übernimmt der Brite Sean Bean Hauers Part des sadistischen Highway-Killers. Jim und Nash – die beiden Opfer aus der 86er-Version – heißen in der Neuauflage Grace (Sophie Bush) und Jim (Zachary Knighton), ansonsten halten sich die Änderungen in Grenzen. Das Studentenpaar ist auf dem Weg in die Semesterferien, als eines Nachts auf einer verregneten Straße eine dunkle Gestalt auftaucht, die Jim zu einem Ausweichmanöver in letzter Sekunde zwingt. Anstatt auszusteigen, entschließen sich beide, weiterzufahren. Doch bei einem Halt an der nächsten Tankstelle treffen sie wieder auf den mysteriösen Fremden. Er überredet Jim, ihn mitzunehmen. Ein tödlicher Fehler.
Produziert von Michael Bays Horrorschmiede Platinum Dunes, die sich u.a. bereits für das erbarmungslose
Texas Chainsaw Massacre-Remake und das erst kürzlich angelaufene Prequel verantwortlich zeichnete, wollte man der Psychopathen-Hatz einen neuen, zeitgemäßen Look verpassen. Dazu holte man sich – fast schon obligatorisch – mit Dave Meyers einen Videoclip-Regisseur an Bord. Wenn schon inhaltlich nicht wirklich ein Mehrwert gegenüber dem Original festzustellen ist, so sollten sich Horrorfreunde wenigstens an dem optischen Styling der Highway-Tristesse erfreuen können. Und zumindest das ist auch gelungen. Wenngleich nicht ganz so düster wie Marcus Nispels
TCM-Neuauflage, wartet der neue
Hitcher mit ordentlich gefilmten versifften Motelzimmern, einem staubigen Wüstenpanorama und von kühlem Neonlicht erhellten Tankstellen auf.
In der Bildkomposition und den einzelnen Arrangements zeigt sich Meyers Erfahrung aus dem Clip-Geschäft. Außerdem weiß er, wie er junge Modell-Typen möglichst effektiv sprich verkaufsfördernd in Szene setzen kann. Die weiblichen Reize einer Sophie Bush kommen auch blutverschmiert noch zur Geltung. Und ihr hartnäckiger Counterpart Sean Bean wird von einem bedrohlichen Licht- und Schattenspiel verhüllt, das für die eine oder andere Schrecksekunde sorgen dürfte. Leider aber auch nicht für mehr. Die größte und offenkundigste Schwäche des Remakes ist seine Vorhersehbarkeit, ganz gleich, ob man das Original kennt oder nicht. Mit Ansage heult die Soundanlage auf, ein „Jetzt wird es spannend!“ soll einem als Zuschauer auf diese Weise wenig subtil eingetrichtert werden.
Das Original von Robert Harmon besaß zumindest in Ansätzen einen psychologischen Unterbau, der vor allem in dem Duell zwischen Hauer und dem von C. Thomas Howell dargestellten Verfolgungsopfer zum Ausdruck kam. Davon ist in der 2006er-Variante nichts mehr zu spüren. Vielmehr haben Meyers und die Platinum Dunes-Mannschaft ihre ganze Energie darauf verwandt, den Gore-Level besonders zum Finale hin nochmals anzuziehen. Dabei sollte eigentlich klar sein, dass es sich um keine Auswahlentscheidung handeln müsste. Denn auch ein Film mit ordentlichen Blutfontänen kann durchaus smart daherkommen.
Saw – der erfolgreichste Horror-Franchise der letzten Jahre – hat letzteres zumindest in Teil 1 bewiesen.
Dass die Suspense lediglich in kurzen von der Tonspur angeheizten Schocksequenzen zu spüren ist, hat seine Ursache auch in einer schlichtweg nicht vorhandenen Charakterzeichnung der beiden vermeintlichen Identifikationsfiguren. Außer in einigen Zeilen Smalltalk („Willst Du später einmal Kinder haben?“) erfährt man nichts über sie. Und wenn einem das Schicksal von Grace und Jim nunmal egal ist, dann bleiben nur die optischen Spielereien Meyers als wirkliches Argument für den Film übrig. Zumal der minimalistische Plot nicht dazu angetan ist, das Interesse des Zuschauers über dreißig Jahre nach Spielbergs
Duell (1971) auf einem messbaren Level zu halten. Das Setting – der endlose Highway als Metapher einer ultimativen Todessehnsucht – musste dafür bereits in zu vielen Genreproduktionen wie
Joyride (2001) oder
Breakdown (1997) als Kulisse herhalten, von denen Meyers neben dem Original-Hitcher-Film sicherlich mitbeeinflusst wurde. Ganz offen zitiert er dafür Hitchcock, wenn Grace und Jim im Motel unter die Dusche steigen und im Anschluss daran
Die Vögel (1963) im TV zu sehen ist. Nur bleibt es bei dieser sinnentleerten Geste. Die Hitchcock’sche Kunst des Filmemachens ist an ihm offenkundig vorbeigerauscht, während er selber noch am Straßenrand stand und den Anhalter geben musste.
Erschienen bei
BlairWitch.