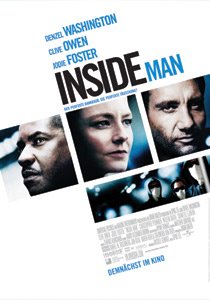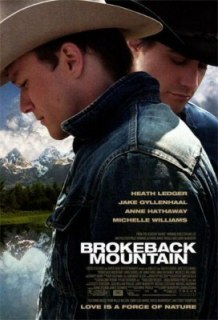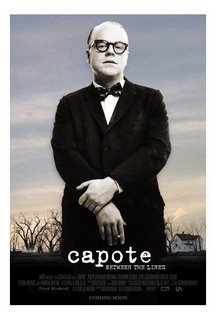C.R.A.Z.Y. - Seelenfutter mit David Bowie und Charles Aznavour

C.R.A.Z.Y. CDN 2005
++++
In „South Park“ sind sie die Verkörperung des Bösen: die Kanadier. Das Land der Eiskunstläufer und Robbenjäger bringt aber auch in unregelmäßigen Abständen Regisseure von Weltformat hervor. Atom Egoyan gehört hierzu, David Cronenberg sicherlich auch. Und vielleicht muss man diese Aufzählung zukünftig um den Namen Jean-Marc Vallée ergänzen, denn seine filmische Reminiszenz an die 60er und 70er Jahre, die Musik von David Bowie und den Rolling Stones, und an die Zeiten zwischen bürgerlichem Alltag und wilden Phantasien aus Sex, Drugs und Rock’n’Roll ist für mich die Kinosensation der letzten Monate. Soeben ausgezeichnet mit fast einem Dutzend kanadischer Filmpreise (ok, wen interessiert’s?) ist „C.R.A.Z.Y.“ all das, was Kino immer sein sollte aber leider allzu oft nicht erreicht. Es ist eine Fahrt auf der größtmöglichen emotionalen Achterbahn geworden, mit skurrilen, lustigen, gefühlvollen und hochdramatischen Momenten, die einem lange in Erinnerung bleiben werden.
Zac Beaulieu (sensibel und charismatisch: Jean-Marc Grondin als jugendlicher Zac und legitimer Nachfolger von Sid Vicious) ist ein ganz besonderer Junge. Schon als kleines Kind wurde Zac von seiner Mutter (Danielle Proulx) zu einer mit seherischen Fähigkeiten ausgestatteten Bekannten mitgeschleppt, die in ihm eine Gabe erkannte, mit denen er anderen Menschen angeblich helfen könnte. Seitdem wurde er von seinem ganzen Bekanntenkreis als „Wunderheiler“ benutzt. Geboren am Heiligen Abend, wächst Zac mit seinen vier Brüdern in einer gut behüteten Arbeiterfamilie im französisch sprechenden Teil Kanadas, genauer in Quebec, auf. Er hat eine Vorliebe für die Platten des David Bowie, flüchtet sich gerne in abenteuerliche Tagträume und hegt eine zunächst noch unentdeckte Leidenschaft für attraktive Jungs. Ob er tatsächlich schwul ist oder nicht, weiß er aber selbst nicht. Er verdrängt es. Immerhin hat er auch eine Freundin, worauf besonders der gestrenge Papa Beaulieu (leistet Großes: Michel Coté) mächtig stolz ist. Hatte dieser doch stets befürchtet, dass Zac womöglich ein „Homo“ sein könnte. Damit würde für ihn eine Welt zusammenbrechen.
So wenig revolutionär der Plot auch erscheinen mag, eigentlich ist „C.R.A.Z.Y.“ eine klassische Coming of Age-Story, die Qualität des Films liegt eindeutig in der Art der Inszenierung und der Herangehensweise von Regisseur und Drehbuchautor Vallée. Mit soviel Empathie und Zuneigung wurden selten Kindheits-/Jugenderinnerungen geschildert, jede Szene atmet Vallées Hingabe an sein Ensemble, auch an die sehr ambivalente Figur des Vaters, dass es schlichtweg eine unbeschreibliche Freude ist für zwei Stunden in den Kosmos dieser Familie Beaulieu eintauchen zu dürfen. Es stellt sich ein wohliges Glücksgefühl ein, was einen trotz mancher dramatischen Tiefschläge so schnell nicht verlassen wird. „C.R.A.Z.Y.“ gehört zu der seltenen Spezies an Filmen, die bei einem bleiben und in uns weiter wachsen, weil die Bilder einfach zu stark sind, um sie nach dem Kinobesuch vergessen zu können.
Um nicht zuviel vorweg zu nehmen, so seien an dieser Stelle eher vage auf Zacs Erlebnisse während des Weihnachtsgottesdienstes und die Gesangseinlagen im heimischen Kinderzimmer hingewiesen, beides Szenen, in denen die grandiose Musik („Space Oddity“ wurde noch nie derart wirkungsvoll in einem Kinofilm eingesetzt) mit der Stimmungslage des jugendlichen Rebells wider Willen verschmelzen. Und wir als Zuschauer versinken in einem nostalgischen Klangteppich, der sich fast zu kuschelig weich anfühlt, um nicht als Kitsch tituliert zu werden. Nein, von Kitsch ist „C.R.A.Z.Y.“ dennoch weit entfernt, denn die rosarote Brille bekommt immer wieder empfindliche Kratzer. Es berührt, wenn Zac, ähnlich wie ein gewisser Ennis del Mar, die eigene Neigung nicht akzeptieren will und in seiner ganzen Verzweiflung Gott anfleht, dieses Schicksal nicht tragen zu müssen. Denn er weiß, dass seine enge Beziehung zu seinem Vater darunter zerbrechen wird. Überhaupt durchlebt Zac eine tiefe Wandlung, was sein Verhältnis zu Religion angeht. Streng katholisch erzogen, Heiligenbilder zieren fast jeden Raum im elterlichen Haus, sagt er sich in der Pubertät von Gott los. Er sei nun Atheist, fertig. Der Wahrheit auch in diesem Punkt ins Auge zu blicken, wird Zac noch einiges an persönlichen Opfern kosten.
So gekonnt Vallée die Musik zur Typisierung und Identitätsstiftung einsetzt, unglaublich starke Auftritte hat auch Michel Coté als Patsy Cline-Verehrer mit dem Hang zur großen Show als Charles Aznavour-Imitator, lebt sein Werk besonders von den vielen kleinen Details, die bekunden, wieviel Herzblut hier ein Filmemacher investiert hat. Die unkonventionelle Methode des Toastens von Madamae Beaulieu, Zacs schüchterne Blicke in Richtung eines Mitschülers oder das Gleichnis des fragenden Wüstengängers. Aus diesen vielen kleinen Mosaiksteinen entsteht ein Gefühl als Zuschauer ganz nah dran an dieser Familie zu sein, die trotz oder gerade wegen ihrer Macken unversehens Einzug in die Herzen des Publikums finden wird. Garantiert. Die für das Genre typische sprunghafte Narration wird immer wieder in ihrem fordernden Tempo durch Zeitlupen aufgehalten, die Ereignisse bebildern, die unerwartet über die Beaulieus und uns hereinbrechen. Da wechseln sie sich wieder ab: Bangen, Hoffen, Freude. Ein Dreiklang, den „C.R.A.Z.Y.“ in jeder Sekunde durchzieht und der zeigt, warum Vallée und sein Co-Autor Francois Boulay zehn Jahre lang mit der Perfektionierung des Skripts beschäftigt waren.
Warum ich so begeistert bin, dürfte spätestens klar werden, wenn der Leser dieser Zeilen den Film gesehen hat. „C.R.A.Z.Y.“ vollbringt nicht nur das Kunststück über 127 Minuten bestens zu unterhalten, Vallée und Boulay gelingt es auch, das Lebensgefühl einer Zeit und ihrer Generation zu zelebrieren, das von einem neuen Geist der Freiheit und der Selbstbestimmtheit beseelt war. Diese tragikomische Chronik der Beaulieus hat das Zeug zum modernen Klassiker, der das Kino endgültig wieder als Ort des Träumens und Erlebens an dem einzig dafür möglichen Platz etabliert: Dem in unseren Herzen.
Erstveröffentlich bei kino.de.