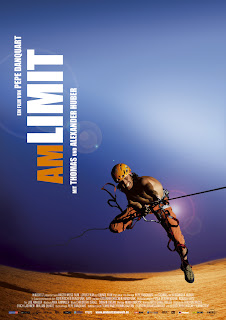Freedom Writers - Club der guten Vorsätze

USA 2006
++1/2
In dem auf Hochglanz polierten Ghetto-Drama Dangerous Minds nahm Michelle Pfeiffer noch erfolgreich den „Kampf“ gegen jugendliche Gang-Gewalt und Problemschüler mit Null Bock-Attitüde auf. Diese Aufgabe fällt in Richard LaGraveneses Feel Good-Movie Freedom Writers der zweifachen Oscar-Preisträgerin Hilary Swank zu. Obwohl vieles zu gewollt und aufdringlich inszeniert ist, kann man sich als Zuschauer nur schwerlich der emotionalen Wucht der Geschichte entziehen.
Kritik:
Wenn es nach der jungen und engagierten Lehrerin Erin Gruwell (Hilary Swank) ginge, die Welt bestünde nur aus hochmotivierten, wissenshungrigen und aufmerksamen Schülern. Doch die Realität sieht anders aus, ganz anders. Als sie mit dem festen Glauben an ihr idealisiertes Schülerbild zum ersten Mal das Klassenzimmer der Wilson High School betritt, sieht sie sich mit Herausforderungen konfrontiert, die ihr alles abverlangen sollen. Ihre Klasse entpuppt sich als eine Ansammlung an Problemkids unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Gangmitglieder, jugendliche Kriminelle, Schüler mit Lernschwächen und aus zerrütteten Familien. Es ist genau jener soziale Topos, der in Deutschland seit vergangenem Jahr untrennbar mit der Berliner Rütli-Schule verbunden ist. Der eigentliche Schulalltag gerät in einem solchen Milieu zur Nebensache.
Doch so leicht will sich Erin nicht geschlagen geben. In der Folge schildert Regisseur und Autor Richard LaGravenese, wie es der mutigen Pädagogin gelingen soll, die anfänglich explosive Stimmung unter den Schülern, den latenten Rassenhass und die gegenseitigen Anfeindungen Stück für Stück abzubauen. Ihre Methoden mögen bei ihrer Vorgesetzten (Imelda Staunton) auf wenig Gegenliebe stoßen, dafür erreicht Erin die Herzen ihrer Schüler und – so das aus vielen ähnlich gelagerten „Based on a True Story“-Geschichten bekannte Kalkül – auch das des Zuschauers.
Hilary Swank tritt in die Fußstapfen so bekannter Vorgänger wie Michelle Pfeiffer und Antonio Banderas. Während Mr. Latin Lover über das Tanzen renitente Möchtegern-Gangster zu Anstand und Disziplin „erziehen“ wollte – wohlgemerkt mit einem unübersehbaren Augenzwinkern – näherte sich die von Pfeiffer verkörperte toughe Ex-Marine über die Literatur ihrer vermeintlichen Chaostruppe. Swanks Charakter tut es ihr gleich. Mit realistischen Geschichten aus dem Ghetto und Literaturklassikern (Das Tagebuch der Anne Frank, Romeo & Julia) versucht sie, bei den Jugendlichen Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken.
Die feste Verankerung in einem realen Vorbild ist für ein solches kathartisches Drama fast schon obligatorisch. Mit dem Wissen, dass irgendwo da draußen nicht nur eine sondern Tausende engagierter „Erins“ tagtäglich ein scheinbar aussichtloses Gefecht zu führen haben, verzeiht man dem Film und dessen Regisseur diverse melodramatische Peinlichkeiten. Klar ist, dass ein auf 90 oder 120 Minuten konzentriertes Destillat Handlungsverläufe immer glättet und zuspitzt. Warum aber letzteres in Freedom Writers vor allem über penetrante Tränendrückerei – Hilary Swank steht in der zweiten Stunde fast fortwährend das Wasser in den Augen – und zu süßlicher Musikuntermalung geschehen muss, bleibt das Geheimnis von LaGravenese. Von einer Steigerung der emotionalen Durchschlagskraft über eine zurückhaltende Inszenierung hält der renommierte New Yorker Drehbuchautor (Der Pferdeflüsterer, Beloved) offenkundig nichts.
Aber es gibt sie dann doch. Jene Momente, in denen der Funken überspringt. In denen man nicht anders kann, als mitzufühlen und nachzuempfinden, was es heißt, an diesem Ort aufwachsen zu müssen. Wenn die Jugendlichen ihre Erlebnisse mit Gewalt und Perspektivlosigkeit über das Schreiben zu verarbeiten lernen, oder sie mit den schlimmsten Konsequenzen eines fanatischen Rassenhasses unmittelbar konfrontiert werden, dann bewahrheitet sich die von US-Kritikerlegende Roger Ebert formulierte Erkenntnis: „People more readily cry at movies not because of sadness, but because of goodness and courage.“ Güte und Mut, davon haben Erins Kids im Überfluss. Man muss ihnen nur eine Chance geben, es auch zu beweisen.
Für Programmkino.de.