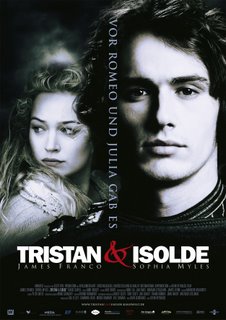Breakfast on Pluto - Auf der Suche nach Mitzi Gaynor
 IRL/GB 2005
IRL/GB 2005+++
Ein Leben in 36 Kapiteln. Was sich anhört, als presse ein Regisseur eine auf wahren Begebenheiten basierende Story ohne Rücksicht in ein starres Korsett, ist die kurzmöglichste Zusammenfassung für ein phantasiereiches, imaginatives, erfrischendes Kinoerlebnis. Patrick bzw. Patricia „Kitten“ Braden (Cillian Murphy) merkt bereits früh, dass er anders ist als die anderen Kinder in seinem Alter. Patrick hegt ein größeres Interesse fürs Schminken als für Fußball. Gerne trägt er auch schon einmal ein Kleid mit den dazu passenden hochhackigen Schuhen. Die Schmerzgrenze ist erreicht, als er den neu eingerichteten Kummerkasten in der Schule für die Frage nach dem richtigen Ort für eine Geschlechtsumwandlung zweckentfremdet. Im streng katholischen Umfeld seiner (nord)-irischen Heimat ein Skandal, zumal sich der Einfluss miefigen 50er Jahre noch hartnäckig hält. Aufgewachsen bei Adoptiveltern, beschließt Patrick die Flucht nach vorne anzutreten und seine leibliche Mutter zu suchen. Dafür begibt er sich nach London, in die Stadt, die niemals schläft.
Nach drei Jahren Abstinenz vom Regiestuhl kehrt Irlands Filmemacher Nr.1, Neil Jordan, mit „Breakfast on Pluto“ fulminant auf den Radarschirm des anspruchsvollen Kinos zurück. Noch bevor die schwulen Cowboys ihren Siegeszug antraten und Schauspielerinnen für die Verkörperung von Transsexuellen mit Preisen überhäuft wurden, entschied sich Jordan, dieses etwas andere Transgender-Drama mit einem unverwechselbaren Glamour-Appeal zu realisieren. Die Suche nach der Mutter entwickelt sich für Patrick zu einem Trip zurück in seine Vergangenheit und zu seinen Wurzeln. Folgerichtig endet der Film auch in Irland, wo Patrick eine anfangs so nicht für möglich gehaltene „Wohngemeinschaft“ aufmacht. Aber wer Jordan kennt, weiß, dass er es selten dabei belässt, lediglich einen Aspekt einer Geschichte zu beleuchten. Spätestens seit „The Crying Game“ und „Michael Collins“, das Epos über den irischen Freiheitskämpfer, gilt er neben Jim Sheridan als einer der politischsten Köpfe der irischen Filmlandschaft. Und so kreuzen den zentralen Coming-of-Age-Plot immer wieder die blutgetränkten Pfade des Nordirland-Konflikts.
Hierbei erstaunt, wie mühelos und treffend Jordan zwischen den unterschiedlichen Genres und Stimmungen wechselt. Eine vollkommen friedliche Situation kann sich bereits im nächsten Moment in die sprichwörtliche Hölle verwandeln, die alles verändern soll. Diese Nackenschläge sitzen, sie hinterlassen beim Zuschauer mit Sicherheit eine mindestens so starke Nachwirkung, wie die zahlreichen ungewöhnlichen charmanten Drehbucheinfälle. Von Rotkehlchen, die untertitelt (!) das Geschehen kommentieren, über einen Ausflug in die Märchenwelt einer „Alice im Wunderland“ bis hin zu Kittens fast außerirdischer Selbstdarstellung als Show-Königin zwischen Schwulenstrich und billiger Hypnose-Darbietung, ein Hauch von „Amélie“ weht durch die neonlichtüberfluteten Gassen des Londoner Nachtlebens. Andere Regisseurre bestreiten mit diesen Ideen und Stilmittel ihre gesamte Karriere, Jordan packt sie gleich in einen einzigen Film.
Wer über „Breakfast on Pluto“ schreibt oder redet und nicht Cillian Murphys Darstellung des zutiefst optimistischen Patrick „Kitten“ Braden erwähnt, begeht einen nicht entschuldbaren Fauxpas. Der soeben 30 Jahre alt gewordene Murphy, zuletzt in Wes Cravens Thriller „Red Eye“ als skrupelloser Flugzeugentführer zu sehen, geht in seiner Rolle auf, wie ich es in letzter Zeit nur in ähnlicher Intensität bei Felicity Huffman und ihrer Verkörperung der ebenfalls transsexuellen Bree erlebt habe (Notiz: Sind Transsexuelle vielleicht besonders dankbare Charaktere?). Wie selbstverständlich stolziert Murphy in High Heels und Pelzmantel das Kopfsteinpflaster entlang, während seine Mimik und Gestik ein Selbstbewusstsein transportiert, das von uns zu jeder Zeit unmissverständlich Respekt für sein Alter Ego einfordert. Wie leicht hätte es sich dieser Patrick „Kitten“ Braden nur machen können, hätte er seine Neigung und sein Wesen verleugnet, um bloß nicht aufzufallen. Dass er an die Option eines bürgerlichen Angepaßtseins nie auch nur einen Gedanken zu verschwenden scheint, erhebt ihn zu einer mutigen Figur mit Vorbildcharakter. Sogar in der heutigen Zeit.
Die Zeitreise zurück in die 60er und 70er Jahre illustriert „Breakfast on Pluto“ stilecht mit einem nostalgischen Soundtrack, der mit The Rubettes und ihrem „Sugar Baby Love“ und T.Rex’ „Children of the Revolution“ zwei der ganz großen emotionalen musikalischen Höhepunkte der damaligen Zeit beinhaltet. Kittens Revolution und Rebellion gegen all die Widerstände entfaltet sich auf die Weise in eine für uns unmittelbar nachzuempfindene Universalität. „Music is the Key“ sang einst eine gerne belächelte Sängerin aus Delmenhorst. Recht hat sie. Kitten ist dafür der lebende Beweis.
Kritik bezieht sich auf die OV.