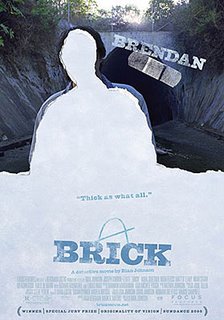USA 2006
+++1/2„
Es wird gebahnt ein Weg durch Gewalt.“(Vergil)
Nacht über Miami. Die Schwüle des Tages entlädt sich in einem beeindruckenden Sommergewitter. Blitze zucken, Donnerhall. Und aus einer Discothek hämmern hypnotische Beats. Das ist die Welt von James „Sonny“ Crockett und Ricardo Tubbs. In der Kinoadaption der legendären 80er-Designervorführung in flockigen Pastellfarben ist das Künstliche aus dem Bild verbannt worden. Stattdessen herrscht ein ganz anderer fast schon naturalistischer Ton vor. Von der ersten bis zur letzten Minute. Hier ist das Gefühl der fiebrigen Florida-Hitze mit allen Sinnen zu greifen. Sogar der Geschmack des Mojitos zergeht einem beim Zusehen auf der Zunge. Wem wir das zu verdanken haben? Einzig Michael Mann und seinem Partner hinter Kamera: Dion Beebe. Was bereits bei Manns letztem Film „Collateral“ zumindest als dichtes Stimmungsbild funktionierte, führen beide in
„Miami Vice“ nahe an einen Punkt der Perfektion. Das Aufsaugen der verlorenen aber dennoch hoffnungsvollen Atmosphäre vernebelt einem als Zuschauer die Sinne. Das hat natürlich Kalkül, lenkt es doch davon ab, dass der Plot eigentlich nicht dazu taugt, um über 130 Minuten ausgewälzt zu werden.
Klar es geht um Drogen, vielleicht noch andere illegale Geschäfte, Waffen, das übliche halt. Als Undercover-Cops sollen Crockett und Tubbs das Netzwerk eines mächtigen Kartellchefs (Luis Tosar) durchleuchten, Deals verfolgen, um so einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu identifizieren. Geschenkt. Zumal sich der Film am Ende selbst nicht darum schert, den Oberschurken zu enttarnen. Wer nach der nicht vorhandenen Exposition sich noch ernsthaft fragt, wann endlich der Cadillac durchs Bild gefahren kommt, während die Flamingos der Sonne entgegen flattern, dem muss Michael Manns sehr freie Überarbeitung der Serie, die er einst als ausführender Produzent begleitete, wie eine chinesische Wasserfolter kommen. Tropfen für Tropfen schwindet die Hoffnung, eine Reise zurück in die eigene Jugend/Kindheit unternehmen zu können. Das tut weh, besonders dann, wenn man sich nicht von den Prinzipien der Serie lösen kann oder will. Alle anderen, die nicht irgendwelchen Sentimentalitäten nachhängen, können von der Lässigkeit und Eitelkeit des Films und seiner Macher angeekelt sein. Denn schon lange hat uns ein Film nicht mehr so dreist entgegen geschrieen:
„Seht her! Wir haben zwei echte Hollywood-Beaus, viele Knarren, aufgemotzte oder neudeutsch gepimpte Karren und unzählige heiße Babes am Start. Und damit drehen wir ein Ding, das sich einen Dreck um Eure Erwartungen schert!“Ernstsein will gelernt sein, ebenso wie Coolsein. Und in beidem sind Crockett und Tubbs wahre Meister. Oder sollen wir besser von Farrell und Foxx sprechen? Viel eher als die beiden Miami-Cops spielen beide nämlich ihr eigenes Image. Farrell der Womanizer, Foxx der knallharte übercoole Macker. Da wird das Duschen wie einst bei Will Smith in „I, Robot“ zu einer Zelebrierung der eigenen Männlichkeit. Frauen sind dazu da, um einem den Rücken einzuseifen, wenn sie sich nicht gerade von den Liebeskünsten zu überzeugen haben. Das alles ist nichts weiter als ein einziges gigantisches Muskelspiel oder – ordinärer ausgedrückt- ein überlanger Schwanzvergleich. Und doch, wer sich die Mühe macht hinter die testosterongetränkten Posen zu blicken, der entdeckt womöglich, wie zwei einsame Herzen in ihrer Brust nach Sauerstoff lechzen. Nicht das Adrenalin hält diesen Muskel am Schlagen, sondern die (unerfüllte) Sehnsucht nach echter Intimität. Tubbs hat seine Liebe bereits gefunden, Sonny probiert und wirft weg, probiert und wirft weg. Bevor er seine neueste Eroberung (Gong Li) entsorgen kann, droht er selbst zum Spielball zu werden. Ein Bauernopfern in einem größeren Krieg. Denn seine Geliebte ist die engste Vertraute des Kartellchefs und somit eigentlich emotionales Sperrgebiet. Die Betonung liegt auf „eigentlich“.
Schrieb ich eingangs, dass Michael Mann kein wirkliches Interesse für seinen gewöhnlichen Plot aufbringen kann, weil er an der Form hängt und diese zur Perfektion treibt, dann klingt das negativer, als es gemeint war. Die von Kameramann Dion Beebe weiterentwickelte Arbeit mit Digitalaufnahmen verleihen
„Miami Vice“ einen Look, der als atemberaubend zu bezeichnen noch einer mittelschweren Untertreibung gleichkommt. In Kombination mit einem erstklassigen Sounddesign ist die Illusion von „Sex & Crime“ in einer rauen lebensfeindlichen und zugleich zum Sterben schönen Szenerie perfekt. Der Ausflug von Sonny und seiner mysteriösen Geliebten nach Kuba, das scheinbar schwerelose Gleiten über den nebelbedeckten Regenwald oder die als Hintergrundbild verwendeten Lichter der Großstadt Miami, kein Bild möchte man hinterher missen, keine Einstellung verpassen. Nicht, dass es für die filmische Handlung notwendig wäre, nein (viel schlimmer) es ist der reine Luxus, den man von Mann vorgesetzt bekommt. Parallelen zu Malicks „The New World“ tun sich auf. Doch während letzterer mit seiner esoterisch-kitschigen Penetranz aus Bilderrausch, Voice-Over und Farrells Dackelblick nach spätestens einer halbe Stunde nur noch schwer goutierbar wurde, passt bei
„Miami Vice“ die brillante Form zu einem Inhalt, der, wenn nicht durchgehend spektakulär, aber stets die Unsicherheit in sich birgt, nach allen Seiten ausbrechen zu können. Alles ist möglich, niemand ist sicher. Das ist beklemmender, als ein maßloses Schwelgen in hirnlosen Explosionen und selbstreferentieller Action.
Dabei verfügt
„Miami Vice“ mit Michael Mann über einen Regisseur, der es versteht, physische Auseinandersetzungen mit ungebremster Härte und Rohheit in Bilder zu übersetzen. Wenn die Waffen sprechen, zucken wir unweigerlich zusammen. Die Gewalt ist ähnlich ungefiltert wie in Manns Opus „Heat“. Die MG-Salven durchbohren nicht nur Körper, sie überbrücken zugleich die Distanz zwischen uns und der Leinwand. Die energetische Kameraführung und der Verzicht auf eine musikalische Untermalung fungieren als Verstärker. So roh fühlte sich Gewalt nur selten an. Ja, Fühlen ist das richtige Stichwort. Für ein Werk, das rational betrachtet verzichtbar ist, dass man aber nach der ersten Ansicht nicht mehr missen möchte, weil es sich so anfühlt, als ginge es um Kino, das keine Kompromisse kennt.
Erschienen bei
Kino.de.

 USA 2006
USA 2006

 D 2006
D 2006